- 16 -
B. Erforschungsgeschichte
Die Erforschung des Tauernfensters und seiner Umrahmung sowie des s dlich gelegenen Altkristallins begann im wesentlichen in der Mitte des 19. Jahrhunderts. In den fast 140 Jahren seither entstand bei einer Vielzahl von Untersuchungen eine F lle an Literatur. Die Ansichten nderten sich dabei mit steigendem Kenntnisstand mehrmals.
Der folgende "Abri " einer Erforschungsgeschichte bleibt notgedrungen unvollst ndig. Grundlegende Arbeiten und Ver ffentlichungen, die die Matreier Zone oder unmittelbar das eigene Arbeitsgebiet ber hren, wurden st rker ber cksichtigt. Weiteren Aufschlu gibt das Literaturverzeichnis.
Im Jahre 1774 gibt der Kartograph ANICH die erste richtige und ausf hrliche Darstellung der Durreck-Gruppe. Fr here Karten zeigten statt der Durreck-Gruppe erst einen ausgedehnten Wald; bei sp teren Karten wurde der Raum zwischen Ahrn und Rainbach wenigstens mit Bergen ohne Namen ausgef llt (SCHWARZWEBER 1910).
Die erste geologische Karte des Gebietes, die "Geognostische Karte von Tirol", scheidet 1849 f r das Arbeitsgebiet eine n rdliche "Gruppe des Glimmerschiefers" ("Glimmerschiefer, Hornblende-, Chlorit-, Talk- und Kalkschiefer") und eine s dliche "Gruppe des Thonglimmerschiefers" ("Thonglimmerschiefer, massige und schieferige Kalksteine, abnorme Gebilde des Diorits und Serpentines") sowie einen darin enthaltenen Serpentinbereich aus (s. Abb. 8).
1851 vergleicht STUDER in seiner "Geologie der Schweiz" die Kalkphyllite am Brenner mit denjenigen B ndens und des Wallis. Er beschreibt das allseitige Eintauchen des Zentralgneises unter die Schieferh lle und verweist auf die passive Natur des Zentralgneises.
Die erste grundlegende Erforschung des Tauernfensters beginnt 1853 mit den Arbeiten des Chefgeologen LIPOLD und seiner Hilfsgeologen STUR und PETERS f r die kaiserlich-k niglich Geologische Reichsanstalt in Wien. Ziel dieser Untersuchungen sind genaue Kartenaufnahmen. STUR, der die Begehung des Tauernhauptkammes bernimmt, pr gt 1854 den Begriff "Schieferh lle" (NIEDZWIEDZKI 1872), beschreibt sie als "regellose Abfolge" von Glimmerschiefern, Dolomiten, Kalkglimmerschiefer, Chloritschiefer, Talkschiefer und Serpentin - den er als wesentlichen "Bestandtheil der Schieferh lle des Centralgneisses" betrachtet - und verweist auf berg nge der Gesteine untereinander
und in den Zentralgneis. Er konstatiert "unterschiedliches Aushalten" der Schieferh lle in ihrer "Ost-West L ngenerstreckung" und das Einfallen ihrer Schichten "in allen Richtungen vom Gneiss weg".
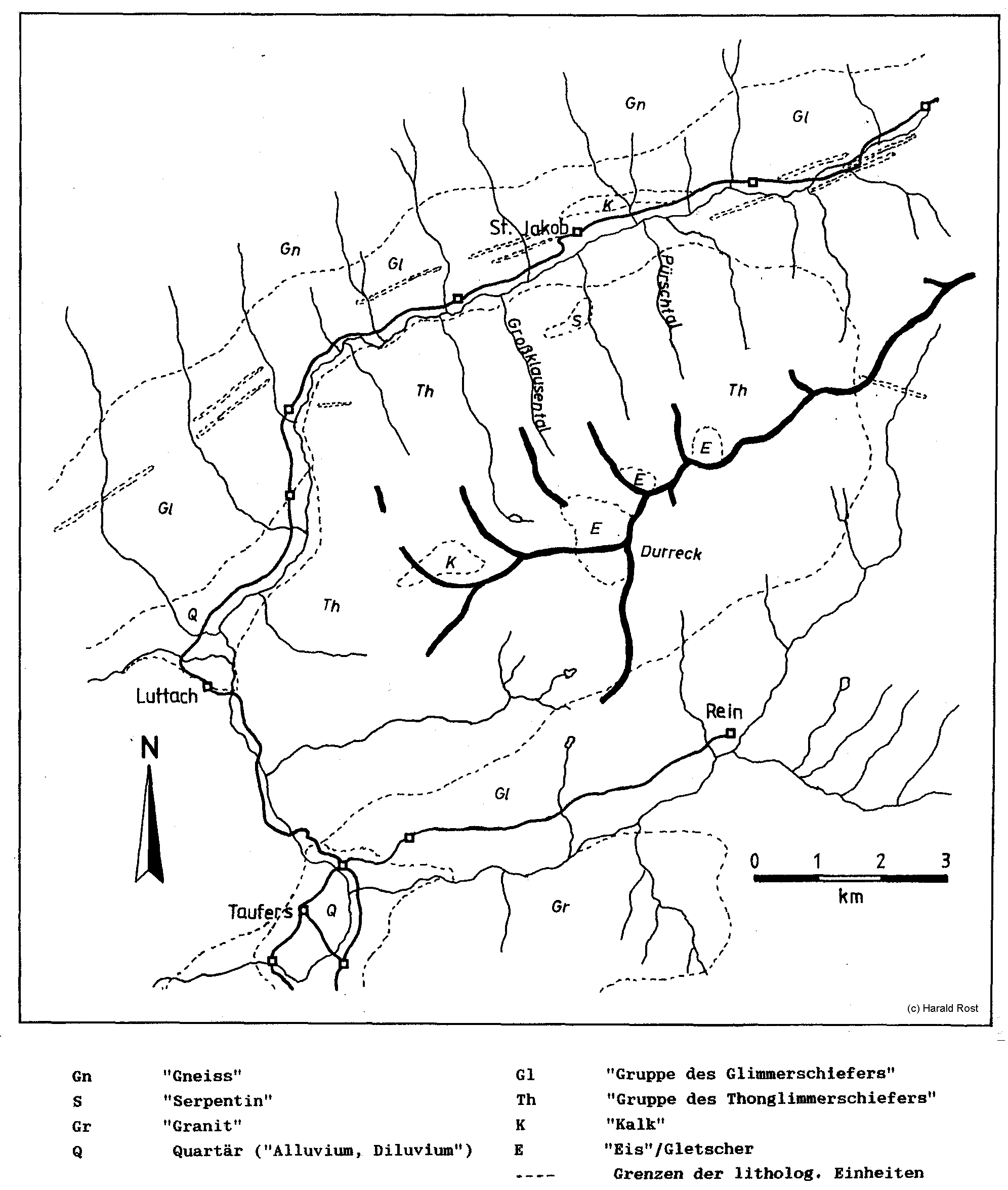
Abb. 8: Geologie der Durreck-Gruppe nach der Geognostischen Karte Tirol
(Online: Kartenausschnitt der geognostischen Karte)
Den Zentralgneis h lt STUR nicht f r den "h chst gehobenen Teil des alten krystallinischen Gebirges" sondern macht ihn als "Zentralgranit" f r die Metamorphose der Schieferh lle "am Ende der Triasformation" verantwortlich. Nach dem Eoz n folgte "(...) eine mechanisch zerst rende Kraft von ungeheuerer Wirkung (...) die es vermochte, die bisher wenig gest rte Ordnung der Dinge, (...) durcheinander zu werfen, das J ngste unter das Aelteste zu lagern (...)." (STUR 1854).
1856 ver ffentlicht STUR eine Reihe von Profilen, die vom Zentralgneis bis ins Ostalpine Kristallin reichen. Er erarbeitet die im wesentlichen heute noch g ltige Gro gliederung des Gebietes, verweist auf Unterschiede zwischen n rdlicher und s dlicher "Centralgneiss - berlagerung" und diskutiert Alters- und Lagerungsverh ltnisse.
1871 erfolgt von NIEDZWIEDZKI die Kartierung von "Theilen der Zillerthaler Alpen und der Tauern" deren Ergebnis er 1872 ver ffentlicht. Sein Arbeitsgebiet umfa t dabei auch das Ahrntal und die Durreck-Gruppe, "mit Ausnahme der ussersten Partie des Gr. Mostnock." (s. a. Abb. 11, S. 27). "Von fr heren geologischen Arbeiten erscheint f r das Gebiet des Ahrenthales blos die geognostische Karte Tirols (...)", deren Angaben NIEDZWIEDZKI teilweise korrigiert.
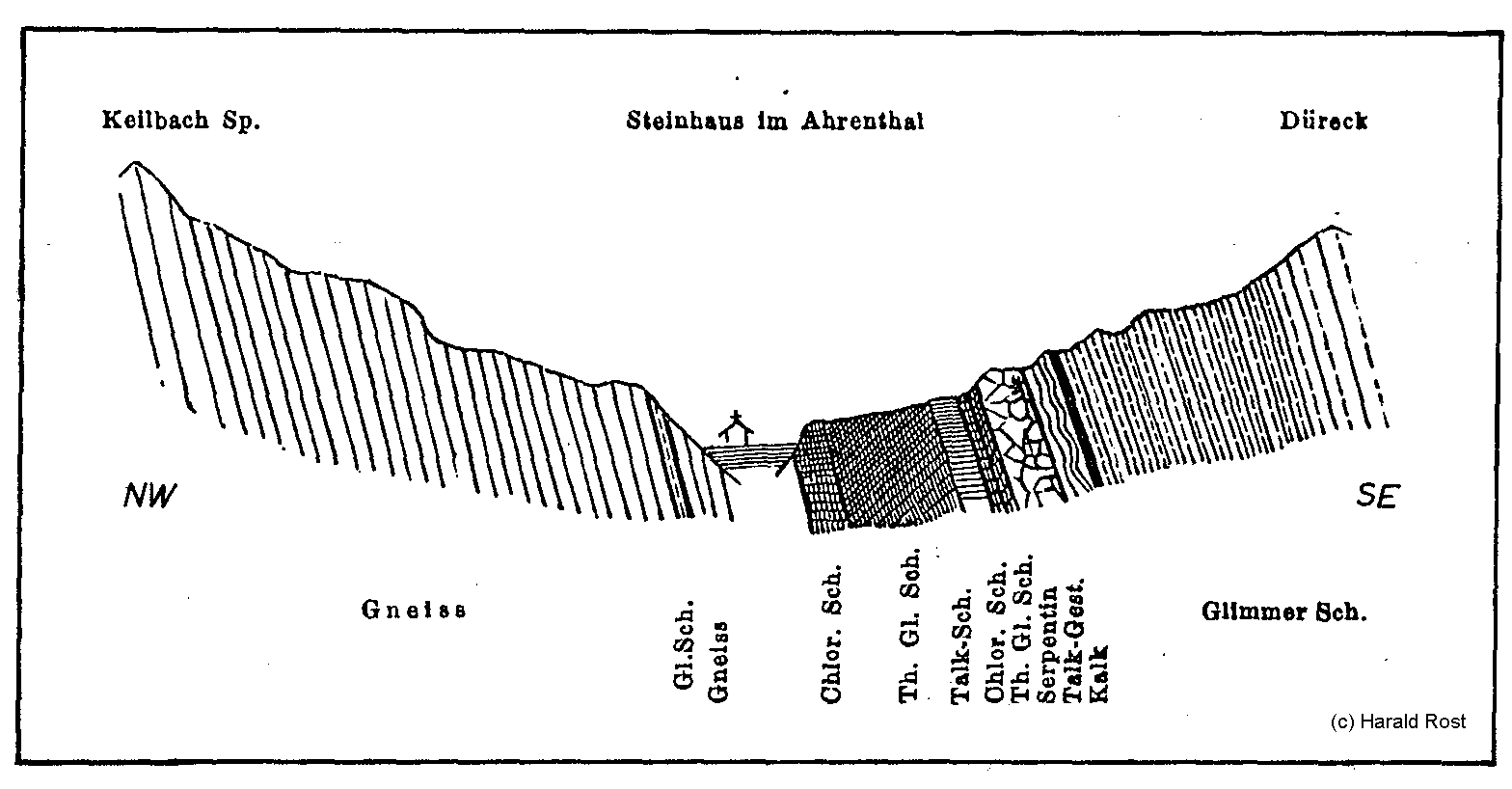
Abb. 9: NW-SE Profil durch das Ahrntal bei Steinhaus (aus NIEDZWIEDZKI 1872).
Das Gebiet des Ahrn- und Virgentales teilt er in drei Zonen ein: "die des Centralgneisses, der 'Schieferh lle' und des Glimmerschiefers, wie sie als allgemeines stratigraphisches Resultat der fr heren geologischen Aufnahmen im Gesammtgebiete der Tauern erkannt wurden." Eine Diskordanz zwischen Schieferh lle und Glimmerschiefer lehnt er ab und fordert eine "continuierliche Folge der Ablagerung der betreffenden Gesteinsformationen".
Die Schieferh lle besteht nach NIEDZWIEDZKI berwiegend aus "Thonglimmerschiefer", "Talkschiefer", "Chloritschiefer", "Quarzitschiefer", "Kalkstein" und "Serpentin". "Neben der Serpentinmasse im Ahrenthale, (...) erscheint auch ein ganz ungew hnliches Gestein (...). Es ist ein Talkgestein (...) von der Art des sogenannten Specksteins (...)." (NIEDZWIEDZKI 1872).
1872 teilt STACHE die Schieferh lle in 2 Gruppen mit "au eralpinem Randgebirgscharakter" und 3 Gruppen mit "inneralpinem petrographischem Faciescharakter" ein. Den Zentralgneis h lt er f r ltestes Grundgebirge.
Wahrscheinlich 1877 wird das Durreck von ARNOLD aus M nchen zusammen mit AUSSERHOFER aus Rain erstmals bestiegen.
L WLs Arbeiten, die ab 1881 erscheinen, sind f r die weitere Erforschung der Matreier Zone von gro er Bedeutung. In einem Profil erfa t er 1881 u.a. einen Bereich zwischen Raintal und "Ahren-Thale bei Steinhaus" (s. a. Abb. 11, S. 27). In einer schematischen Darstellung gibt er von S den nach Norden daf r eine Abfolge von Glimmerschiefer, Phyllit, Kalk, Phyllit, Serizitschiefer, Phyllit, Chloritschiefer, Phyllit, Serizitschiefer, Phyllit und Chloritschiefer an.
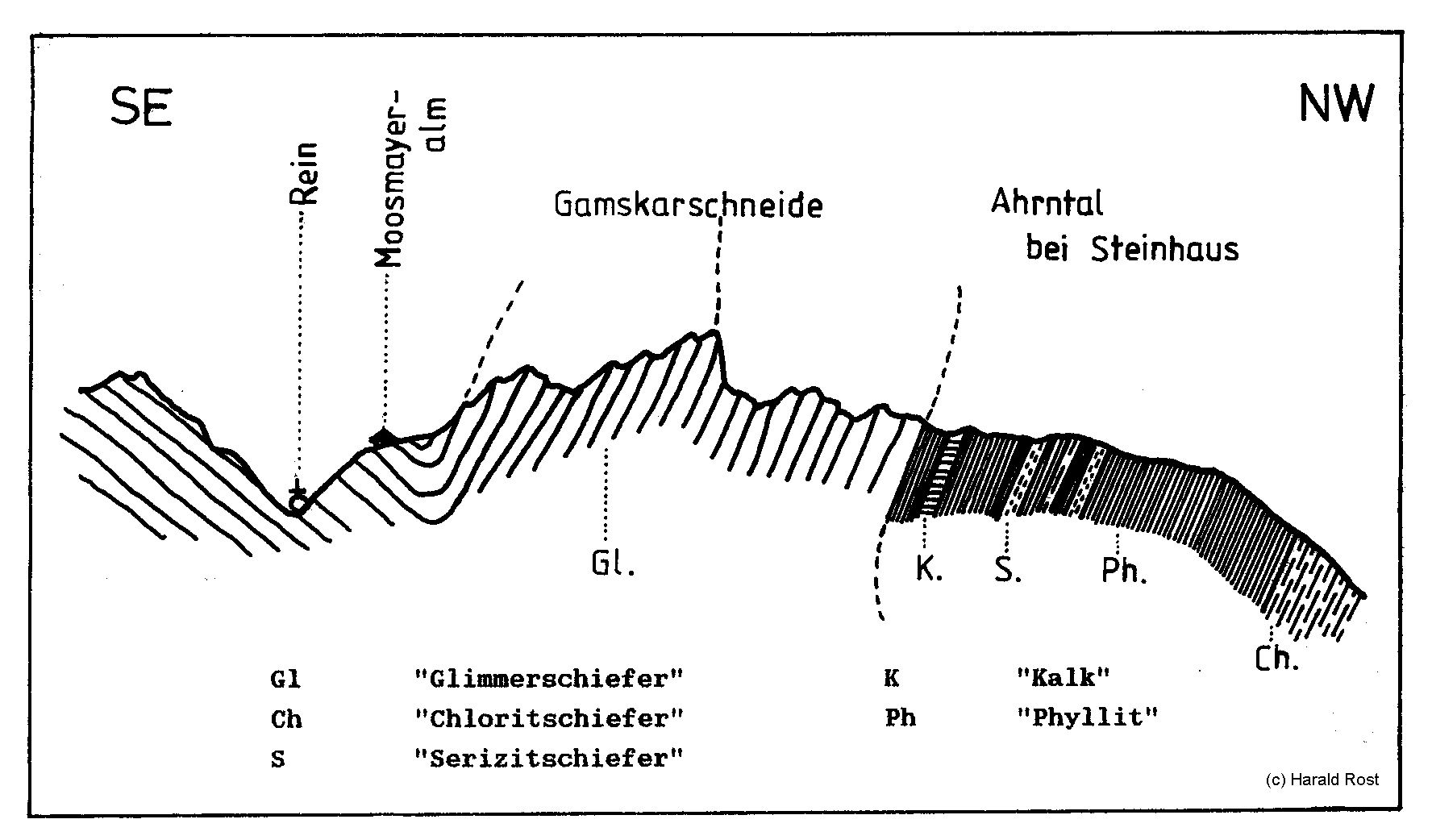
Abb. 10: SE-NW Profil vom Rain- zum Ahrntal nach L WL (1881) (umgezeichnet).
F r das "Klausenthal" beschreibt er die Zusammensetzung der "Phyllitischen Schichtenreihe" ("Phyllit", "Chloritschiefer mit Serpentinlagern", "Sericitschiefer" - der dem Talkschiefer NIEDZWIEDZKIs entsprechen soll, eingeschaltet "k rniger Kalk"). Zur Tektonik schreibt er: Der Tauernkamm zwischen "Rein- und dem Ahrenthale erweist sich daher als eine am Rande der grossen Zillerthaler Gneissmasse gestaute und gegen Norden berst rzte Falte." (L WL 1881).
Ab 1882 ver ffentlicht TELLER mit den Bl ttern Hippach und Wildgerlosspitze, Gro glockner, Hofgastein, Bruneck, Lienz und M lltal zusammenh ngende geologische Karten im Ma stab 1:75000.
Unter Bezugnahme auf die Profile von STUR, PETERS u.a. schreibt er 1882, "Dass die steil aufgerichteten, zum Theil berkippten Schichtfolgen dieses Gebietes nicht einem einfachen, die gesammte Tauerngneissmasse berspannenden Faltenwurf angeh ren, sondern Elemente eines complicirteren Systemes berschobener Falten darstellen (...). Die St rungserscheinungen am S drande der Tauernkette erl schen, (...), schon in den n rdlichen Seitenth lern des Ahrenthales vor Steinhaus. Hier fallen die Gesteine der Kalkphyllitgruppe [Schieferh lle; Anm. d. Verf.] in steiler Schichtstellung von dem Gneisskern in S d ab. Die nach Nord gerichtete berschiebung an der s dlichen Grenze dieser (...) Schichtgruppe setzt dagegen weit nach Ost fort. Sie ist im Gebirgsst ck zwischen Ahren- und Reinthal, auf dem Klammljoch, im Trojer-Thal und in dem Grenzkamm zwischen Virgen und Defereggen bis in's Iselthal hin ber nachzuweisen." (TELLER 1882).
1883 folgt PICHLER mit der Beschreibung der Passivit t des Zentralgneises den Ansichten STUDERs und beschreibt die Schieferh llenmetamorphose als unabh ngig von der Zentralgneisintrusion.
In der geologischen bersichtskarte der Alpen (1:1000000) von NOE wird 1890 s dlich des Zentralgneises f r das untersuchte Gebiet eine Zweiteilung in "Glimmerschiefer, Kalkglimmerschiefer, Chloritschiefer, Talkschiefer, Hornblendegesteine" und in die "Gruppe der Phyllite (Thonschiefer, Thonglimmerschiefer, Quarzphyllit, Kalkphyllit)" vorgenommen.
1897 schreibt L WL von einem "Kals-Matreier Schieferzug", vollzieht eine Abtrennung der Glanzschiefer von den "alten krystallinen Schiefern der Tauern" und stuft sie als j ngere Decke triadischen oder j ngeren Alters ein.
1903 grenzt er erstmals eine Zone von "Matreier Schichten" klar ab: "Den alten Kalkglimmerschiefern scheint der Matreier Schieferzug gleichf rmig aufgelagert zu sein (...). Sicher nachgewiesen aber ist ein Bruch, und zwar ein seigerer Bruch am S drand des Matreier Zuges, an der Grenze gegen den alten Glimmerschiefer." Er gliedert die Matreier Schichten, die er f r "vermutlich obertriadisch" h lt, in einen oberen und unteren Schieferkomplex (aus SCHMIDT 1950).
Ebenfalls 1903 ver ffentlicht WEINSCHENK die Resultate seiner petrographischen Untersuchungen in den Hohen Tauern, bei denen er sich vornehmlich mit Gesteinen der Schieferh lle besch ftigte.
DIENER verweist 1903 auf die von L WL, TELLER und BECKE aufgezeigte nordw rts berkippte Antiklinale, die sich im Zuge des Mostock [gemeint ist der Mostnock] aufw lbt und deren Glimmerschiefer mit steilem S-Fallen auf den Kalkphylliten liegen. Nach DIENER findet "Die berschiebung der Kalkphyllite des Ahrentales durch den Glimmerschieferzug am Mostock (...) ihr Gegenst ck in der gleichfalls nordw rts gerichteten berschiebung der Matreier Schichten (Trias?) des Iseltales durch die Glimmerschiefer des Rothkogels." In diesem Zusammenhang spricht er von einer "Matreier berschiebung". Im Gegensatz zu L WL h lt DIENER mesozoisches Alter gewisser Teile der Schieferh lle aufgrund fehlender beweiskr ftiger Fossilfunde f r zweifelhaft.
1903 bertr gt TERMIER die Schubdeckentheorie auf die Ostalpen und erkl rt die Tauern erstmalig zum Fenster. Mit ihm beginnen die gro en modernen Synthesen der Vorstellungen ber die Ostalpen.
Vom Zentralgneis bis zum Ostalpinen Kristallin gliedert er in 5 Einheiten und orientiert sich damit an den Arbeiten von L WL und STUR. Die Schieferh lle sieht er als komplex-tektonische Serie mit Triasz gen. Die Kalkphyllite der "Oberen" Schieferh lle vergleicht er mit den "Schistes Lustr s" der Westalpen und postuliert damit deren mesozoisches Alter.
Von STEINMANN wird 1905 der Begriff der "ostalpinen Decke" eingef hrt (STAUB 1922).
Von 1906-1910 studieren UHLIG, BECKE, STARK, KOBER, TRAUTH, SCHMIDT und SEEMANN die Zentralgneiszone.
HERITSCH schlie t sich 1912 im wesentlichen TERMIERs Ausf hrungen an. Schriften STURs und NIEDZWIEDZKIs entnimmt er Hinweise auf eine Fortsetzung der Matreier Zone bis zum Ahrntal. Die Matreier Zone beschreibt er als Wurzelregion der Tauerndecken.
SANDER pr gt 1912 den Begriff der "Tauernkristallisation".
1920 h lt CORNELIUS die Bezeichnung "lepontinisch" - von SUESS f r die Gesamtheit der tektonischen Elemente zwischen helvetischen und ostalpinen Decken eingef hrt - f r berholt, da sich ein Teil dieser lepontinischen Elemente als ostalpin erwiesen hat. Den Namen der penninischen Zone will er als "Begriff einer tektonischen Einheit allererster Ordnung im Aufbau des Alpenk rpers" verstanden wissen.
1921 erscheint, als Ergebnis seiner fr heren Arbeiten, die Geologische Karte Blatt Bressanone (Brixen) im Ma stab 1:100000 von SANDER.
SCHMIDT fa t 1921 die Matreier Zone im S den der hohen Tauern als Mittelschenkel der Semmeringdecke auf und h lt den Hochstegenmarmor im Norden f r ihr quivalent. Der Katschbergzone weist er die gleiche Position zu.
KOBERs Arbeiten begannen 1912. In allen Arbeiten trennt er die Matreier Zone als "Unterostalpin" von der Schieferh lle ab. 1923 erscheint sein "Bau und Entstehung der Alpen". Der "Unterostalpine Lungauridenring" um das Tauernfenster wird geschlossen dargestellt, die gro tektonische Stellung der Matreier Zone genau umrissen. Die berschiebung durch das Ostalpin h lt er f r vorgosauisch.
1924 h lt STAUB in seinem "Bau der Alpen" "(...) die Matreier Zone nicht f r die Wurzel der Radst tterdecken und des Triblaun (...)" und lehnt KOBERs Einstufung ins Unterostalpin ab. Stattdessen fa t er die Matreier Zone als Versch rfungszone der berschiebenden ostalpinen Massen mit dem berschobenen obersten Pennin auf.
SANDERs Erl uterungen zur geologischen Karte von Brixen erscheinen 1925 in italienisch, 1929 in deutsch.
Ab 1928 beschreibt ANGEL die Petrographie und Geologie in der Schobergruppe und rechnet die Matreier Zone - allerdings als eigenst ndige Einheit - zum Pennin.
Die geologische Karte 1:100000 Blatt Monguelfo von BIANCHI, DAL PIAZ und MERLA, in der das Arbeitsgebiet erfa t wird, erscheint 1930. Ebenso wie SANDERs Blatt Brixen ist sie im gleichen Ma stab auch heute kaum verbesserbar.
HOTTINGER folgt 1931 der Vorstellung seines Lehrers STAUB. Er stellt die Matreier Zone ebenfalls als Versch rfungszone des obersten Pennin dar und erg nzt dessen Ausf hrungen.
1934 geht BLESER in seiner Dissertation u.a. auf den "enorm komplizierten Schuppenbau" der Matreier Zone seines Arbeitsgebietes ein.
DAL PIAZ und BIANCHI beschreiben im selben Jahr ausf hrlich Geologie und Petrographie des stlichen S dtirol.
Ein Profil von DAL PIAZ geht ber die Cima del Gatto, ein anderes ber die Cima Chiusetta (s. Abb. 11, S. 27). Das Arbeitsgebiet selbst wird in der "Carta geo-tettonica dell' Alto Adige Orientale e regioni limitrofe" (1:200000) und teilweise auch in einem geologischen Panorama der Durreck-Gruppe erfa t. Der Matreier Zone mi t er weder in tektonischer noch in stratigraphischer Hinsicht besondere Bedeutung zu.
BIANCHI beschreibt u.a. die Gesteine oberhalb des Klausen- und Gro klausentals und fa t sie in der "Serie di Cima Dura" zusammen.
CORNELIUS und CLARs fr here Arbeiten, die auch die Matreier Zone ber hren, schlagen sich 1935 in ihren Erl uterungen zur geologischen Karte des Gro glocknergebietes nieder.
KLEBELSBERGs "Geologie von Tirol" erscheint ebenfalls 1935. Die Matreier Zone sieht er als "(...) tektonisch besonders stark beanspruchte (laminierte, verschuppte) Randzone, in der durch Reduktion gr erer Schichtm chtigkeiten eine gesteigerte Mannigfaltigkeit der Gesteinszusammensetzung auf engem Raume zustande gekommen ist (...)". Des weiteren beschreibt er in seinem Buch ausf hrlich quart rgeologische Ph nomene.
BIANCHI und DAL PIAZ gliedern 1939 das Altkristallin in drei durch St rungen getrennte Einheiten (HAMMERSCHMIDT 1981).
1940 betrachtet CORNELIUS das Tauernfenster als "Ausgangs- und Angelpunkt der Deckentheorie der Ostalpen"; 1941 stellt er das alpidische Alter der Zentralgneise der Hohen Tauern als wahrscheinlich fest (CORNELIUS 1941b).
In 3 Publikationen ver ffentlicht SCHMIDT von 1950-1952 eine umfassende Darstellung der Matreier Zone. Nach den Lagerungsverh ltnissen und Vergleichen mit hnlichen Gebieten gliedert er die Matreier Zone stratigraphisch in Einheiten vorkarbonen bis jungkretazischen Alters. Als vorherrschendes Element der Gro tektonik nennt er den Schuppenbau. SCHMIDT zeigt, da die Matreier Zone bei einer Gesamtbetrachtung berall in sterreich als selbst ndige tektonische Einheit abscheidbar und ihre Auffassung als blo e Versch rfungszone des obersten Pennins nicht haltbar ist. Er gliedert sie in eine mit Pennin stark verschuppte Mischungszone und die eigentliche Matreier Zone, in der er eine n rdliche von einer s dlichen Teildecke abtrennt.
FRASL gliedert aufgrund einer Reihe von Vorarbeiten und jahrelanger eigener Untersuchungen 1958 die Schieferh lle der mittleren Hohen Tauern in 5 stratigraphische Serien:
-
- in ein zweistufiges "Altkristallin",
- in die Habachserie (haupts chlich Altpal ozoikum?),
- in die Wustkogelserie (z.T. Perm? Skyth),
- in eine triadische Karbonatgesteinsserie,
- in eine B ndnerschieferserie mit Ophiolithen (oberste Trias, Jura, Kreide?).
Als "stratigraphische Serie" versteht er ehemalige Sediment- und eventuell Eruptivgesteine, die unter sich engere genetische und daher auch altersm ige Bindungen besitzen als zur n chsten Serie.
1959 teilt TOLLMANN als ein Hauptergebnis seiner Arbeit die bisherige "Oberostalpine Einheit" der Ostalpen in Mittel- und Oberostalpin. Das Zentralalpine Mesozoikum h lt er f r den Schl ssel zum Verst ndnis des Deckenbaus der Ostalpen, welchen er in der Hauptsache als austrisch - vorgosauisch ansieht. Die Matreier Zone stellt er ins Unterostalpin, ber dem im S den des Tauernfensters das mittelostalpine Kristallin folgt.
SCHMIDEGG stimmt 1961 bez glich der Alterseinteilung der Matreier Schichten mit FRASL berein und verweist auf entsprechende eigene Arbeiten von 1947/48. Die Matreier Zone h lt er f r einen tektonischen Mischungshorizont von penninischen Elementen mit der unterostalpinen Serie.
1962 nimmt EXNER an, da die Matreier Zone als d nnes Band im unteren M lltal durchstreicht und "(...) die Vorkommen in der Sonnblick-Sadniggruppe mit jenen an der SE-Ecke des Tauernfensters verbindet."
TOLLMANN stellt die Matreier Zone 1963 in seiner "Ostalpensynthese" zum Unterostalpin und sieht sie als dessen Wurzelzone im Abschnitt des Tauernfensters.
Bei einer tektonischen Analyse eines Bereichs der westlichen Matreier Zone am S drand der Venedigergruppe zeigt BARNICK1965, "(...) da zwischen Penninischer Schieferh lle, Matreier Schuppenzone und Nordsaum des Ober-Ostalpinen Altkristallins keine Diskordanz besteht (...)". F r den untersuchten Bereich folgert er, hnlich wie SCHMIDT 1952, da die Matreier Zone eine tektonische "Mittlerrolle" zwischen peripherer Schieferh lle und N-Saum des Oberostalpinen Altkristallins einnimmt.
1965 erfa t SENARCLENS-GRANCY (1965a) in bersichtsprofilen randlich den S dhang des Durrecks; ein anderes geht u.a. durch das R ttal ber Prettau bis zum Hlg. Geist Joch (s. Abb. 11, S. 27).
Von HANNSS erscheint 1967 "Die morphologischen Grundz ge des Ahrntales", worin er sich auch mit dem Arbeitsgebiet besch ftigt.
1969 stellt NOLLAU hnlich wie 1973SCOLARi &ZIRPOLI fest, da es zwischen ostalpinem Altkristallin und Oberer Schieferh lle keine tektonische Diskordanz gibt und eine Grenzziehung bei der Kartierung ohne Wechsel in der Gesteinsfazies nicht m glich w re.
In dem 10 Jahre nach STAUBs Tod 1971 herausgegebenen Buch "Neue Wege zum Verst ndnis des Ostalpen-Baues" betrachtet dieser die Matreier Zone als Mittelostalpin.
Ebenfalls 1971 geben BAGGIo,DALLAPORTA &ZIRPOLI eine petrographische Gliederung der "Cima Dura Serie".
Die geochemischen und isotopengeologischen Arbeiten beginnen in der Hauptsache Anfangs der 70'er Jahre.
BORSI, MORO, SASSI & ZIRPOLI beschreiben 1973, aufgrund radiometrischer Daten, die Entwicklungsgeschichte des Altkristallins. Arbeiten PURTSCHELLER & SASSIs 1975, SATIRs 1975 (s. S. 8) und anderer folgen.
1975 legt HAMMERSCHMIDT seine Diplomarbeit "Zur Petrographie und Tektonik der Matreier Zone zwischen P rschtal und Hasental, Ahrntal, S dtirol" vor, in der das stlich an diese Arbeit angrenzende Gebiet behandelt wird (s. Abb. 11, S. 27).
SASSI et. al., BORSI et al. und andere unterstreichen die Bedeutung der zum Teil bereits von DAL PIAZ (1934) erkannten tektonischen Linien (DAV und KV) und bauen 1978, basierend auf einer gro en Zahl an radiometrischen Daten, das "Block-Modell" des Altkristallins weiter aus. In ihm wird neben S d-, Mittel- und Nordblock die Cima Dura Serie als eigenst ndiger "Phyllonitic belt" betrachtet.
1979 ermitteln BORSI et al. mit der Rb/Sr-Methode f r den Rieserferner mitteloligoz nes Alter. Das Entstehen der Schmelze durch Anatexis verschiedener Krustengesteine halten sie f r m glich und schlagen einen Zusammenhang der Oligoz nschmelzen mit der Tauernmetamorphose vor.
Ab 1979 werden das Tauernfenster, seine Umrahmung und das Altkristallin im Rahmen von Diplom- und Doktorarbeiten des Instituts f r Geologie und Mineralogie der Universit t Erlangen-N rnberg bearbeitet.
Ein Entwicklungsmodell f r die 3 Bl cke des Altkristallins liefert dabei ST CKHERT 1979. 1982 teilt er den Nordblock in drei Zonen unterschiedlichen Metamorphosegrades (s. S. 7). Die Cima-Dura-Serie sieht er als selbst ndige stratigraphische, nicht aber als selbst ndige tektonische Einheit an.
1980 ergibt die Analyse der alpinen Metamorphose und des Magmatismus durch SASSI, BELLIENI et al., da w hrend des oberen Eoz ns eine Subduktion entlang einer neuen Subduktionsebene unterhalb des Tauernfensters stattgefunden hat. Die alpidische Metamorphose wird in ein Ereignis in der Oberkreide (100 m.a.) und eines an der Wende Oligoz n/Mioz n (20 m.a.) gegliedert.
LAMMERER et al. legen 1981 eine stratigraphische Gliederung der B ndner-Schiefer-Decken des s dwestlichen Tauernfensters vor und untersuchen deren Genese.
Ebenfalls 1981 erkennt HAMMERSCHMIDT den orthogenen Charakter des Augengneises von Sand in Taufers und datiert seine Intrusion auf 445 24 m.a..
1983 erscheint als Synthese einiger Diplomarbeiten des Geologischen Lehrstuhls der Universit t Erlangen-N rnberg die "Geologische Karte des Altkristallins s dlich des Tauernfensters zwischen Pfunderer Tal und Tauferer Tal (S dtirol)" von HOFMANN, KLEINSCHRODT, LIPPERT, MAGER & ST CKHERT.
GODIZART schreibt im Rahmen seiner Diplomarbeit, "Petrographisch - gef gekundliche Untersuchungen in der Matreier Zone und angrenzendem Pennin und Altkristallin im Bereich des Klausberges (Ahrntal, S dtirol)", 1984 ber das westliche Nachbargebiet der vorliegenden Arbeit (s. Abb. 11).
Im selben Jahr erscheint von SCHWAN, ROSSNER, BEHRMANN, HEINRICH, MICHALLIK & TH NKER, unter Verwendung der Ergebnisse einiger Diplomarbeiten des Geologischen Lehrstuhls der Universit t Erlangen-N rnberg, eine Ver ffentlichung ber das Nordwestende des Tauernfensters.
FRISCH stellt 1984 fest, da der Nordrahmen des Tauernfensters das quivalent der Matreier Zone im S den sei und schl gt die Anwendung der Bezeichnung "Matreier Zone" f r die gesamte Zone vor.
1986 erg nzen die Ergebnisse der Untersuchungen von ROTHE im Gebiet zwischen Raintal und Gr. Mostnock das geologische Bild der Durreck-Gruppe (s. Abb. 11).
Entgegen allen fr heren Arbeiten deutet KLEINSCHRODT 1987 die DAV, die im Altkristallin den Nord- vom S dblock trennt, als sinistrale Blattverschiebung.
1988 legt SCHULZ eine umfassende Arbeit ber "Deformation, Metamorphose und Petrographie im ostalpinen Altkristallin s dlich des Tauernfensters" im Bereich der s dlichen Deferegger Alpen vor.
Mit den "Petrographisch-gef gekundlichen Untersuchungen in der Matreier Zone und angrenzendem Pennin und Altkristallin N' Sand in Taufers (Ahrntal, S dtirol)" von D NNEBIER wird eine weitere Arbeit in der Durreck-Gruppe abgeschlossen (s. Abb. 11).
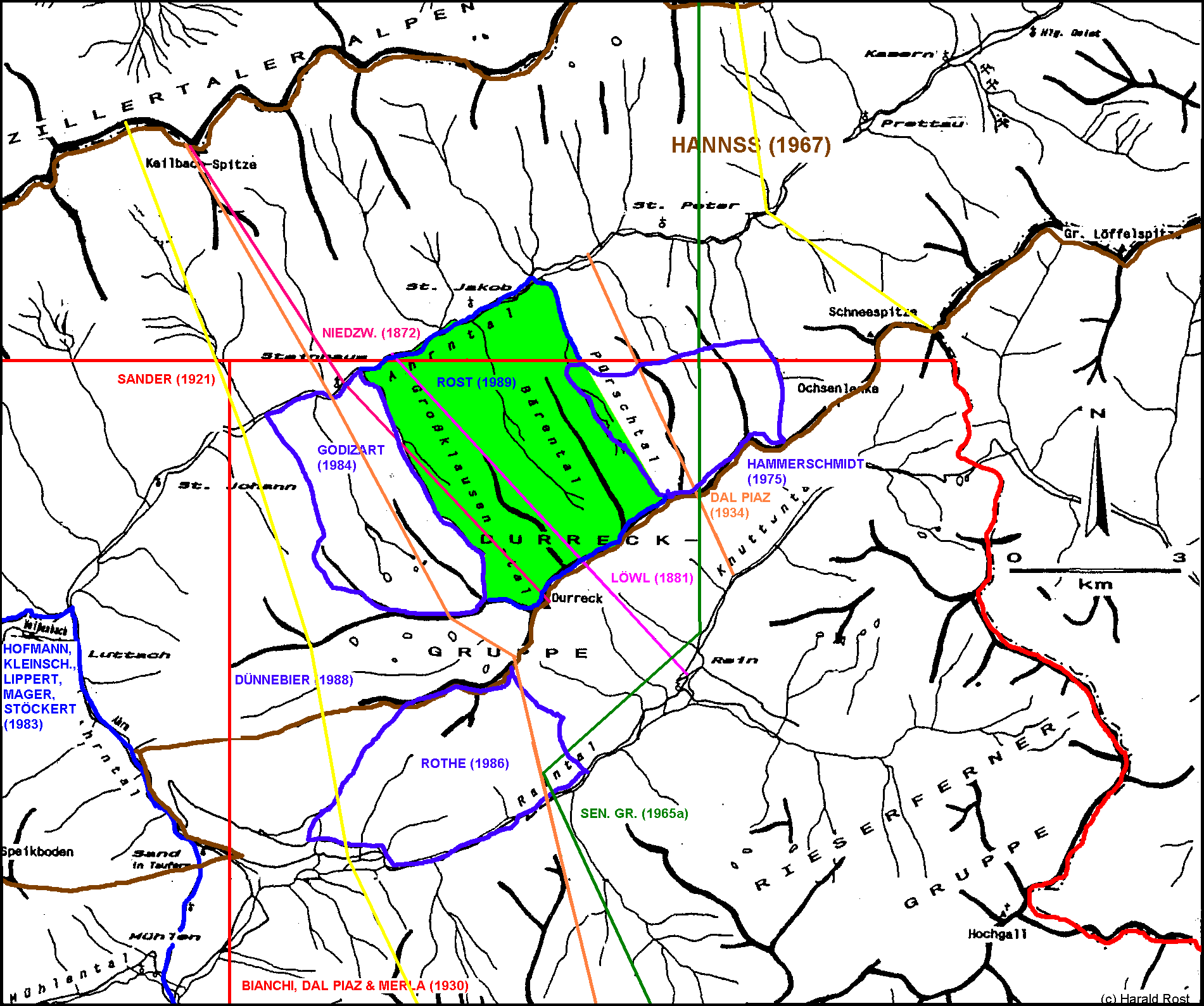
Abb. 11: Kartierungen und Profile in der Durreck-Gruppe und ihrer unmittelbaren Nachbarschaft.
[Gr ne Fl chenmarkierung nur in der Online-Version]
NIEDZWIEDZKI (1872) - (rotes Profil)
L WL (1881) - (pinkes Profil)
SANDER (1921) - (rote Gebietsgrenzen)
BIANCHI, DAL PIAZ & MERLA (1930) - (rote Gebietsgrenzen)
DAL PIAZ (1934) - (orange Profile)
SENARCLENS-GRANCY (1965a) - ( stlich der dkl-gr nen Gebietsbegrenzung)
HANNSS (1967) - (braune Gebietsgrenzen)
HAMMERSCHMIDT (1975) - (blaue Gebietsgrenzen)
HOFMANN, KLEINSCHRODT, LIPPERT, MAGER & ST CKERT (1983) - (blaue Gebietsgrenzen)
GODIZART (1984) - (blaue Gebietsgrenzen)
ROTHE (1986) - (blaue Gebietsgrenzen)
D NNEBIER (1988) - (genau Umgrenzung unbekannt)
ROST (1989) - (blaue Gebietsgrenzen und gr ne Fl chenmarkierung)
[Farbbezeichnungen nur in der Online-Version]
<- Zur ck - Inhaltsverzeichnis - Home -Literaturverzeichnis - Weiter ->
